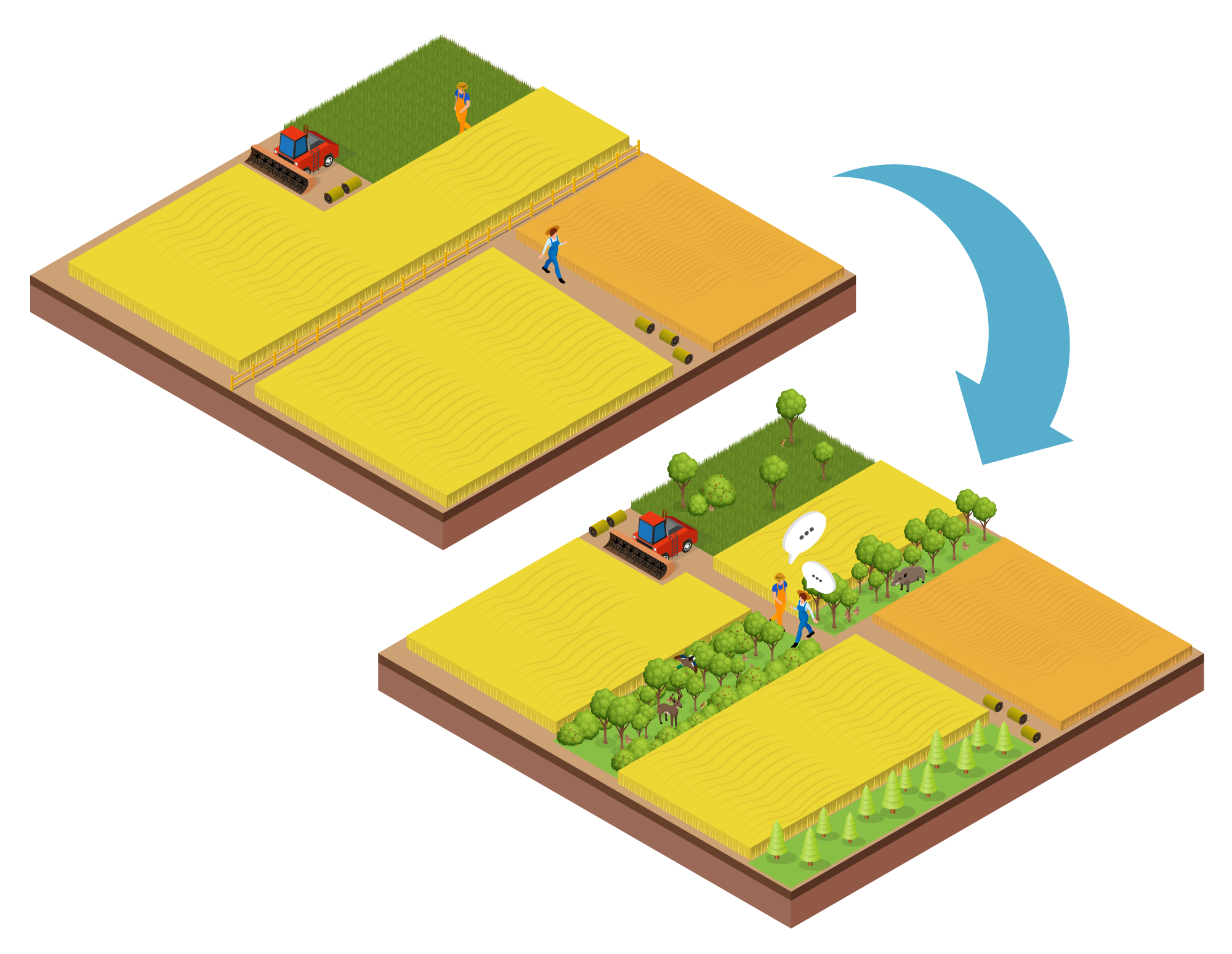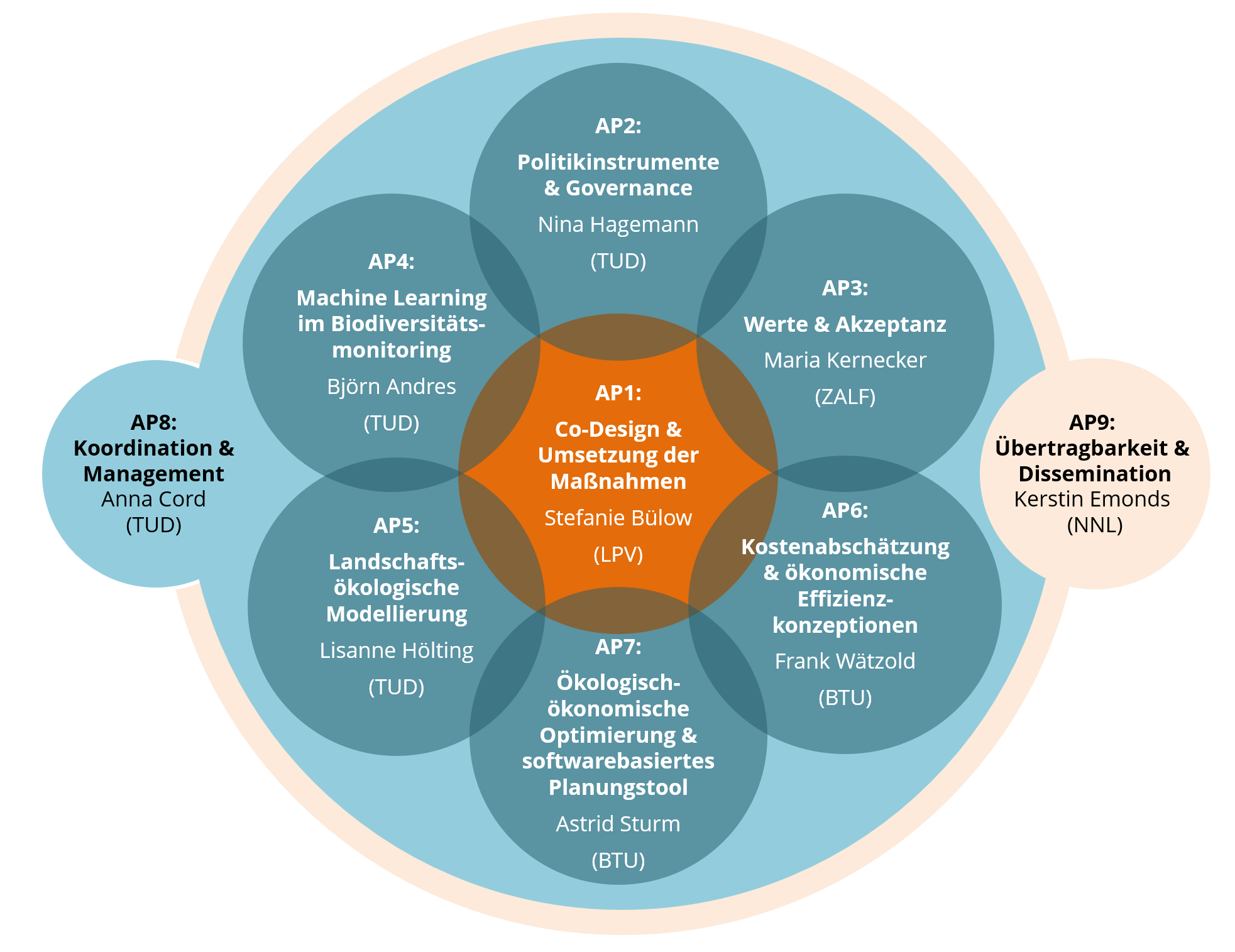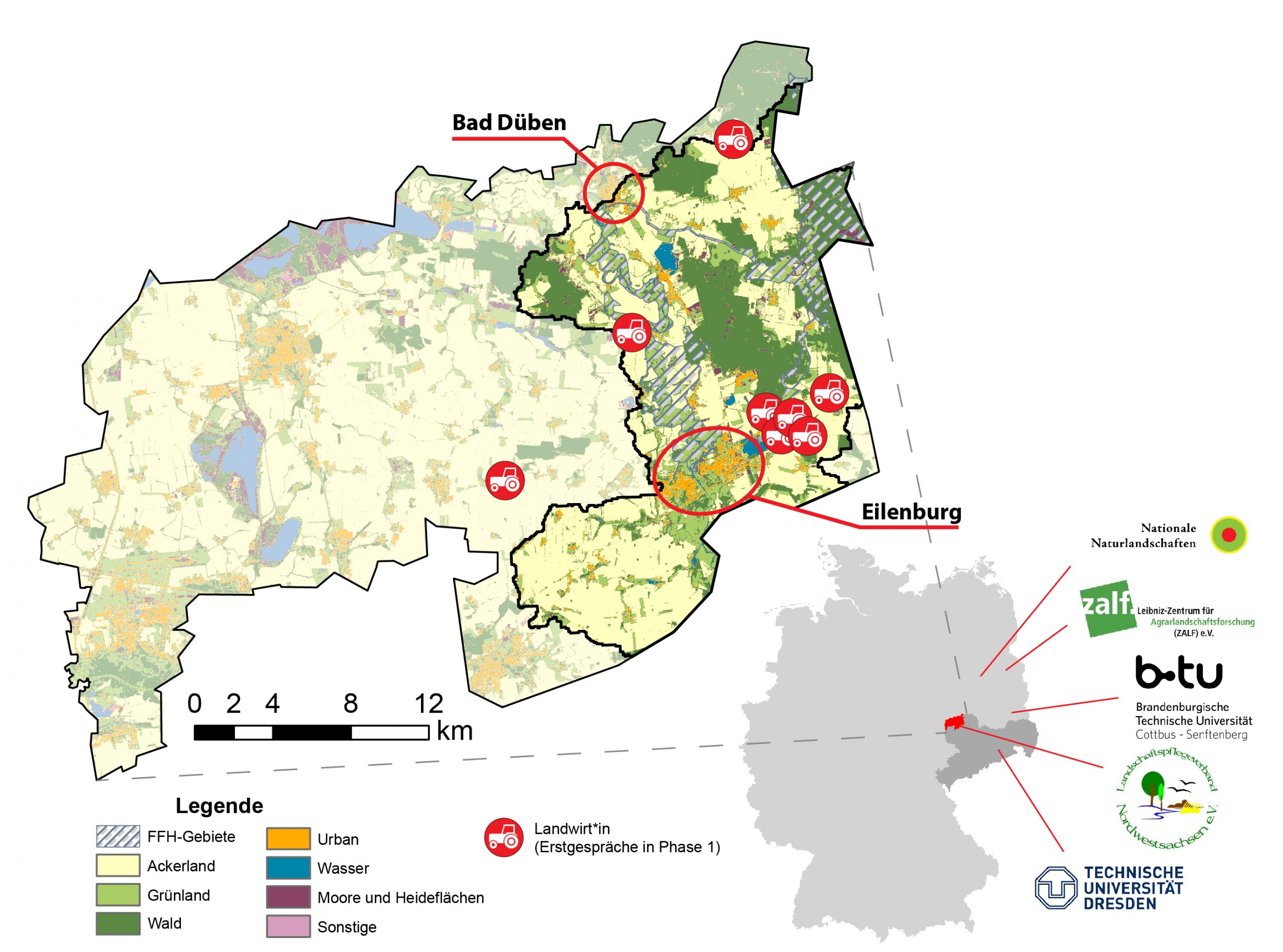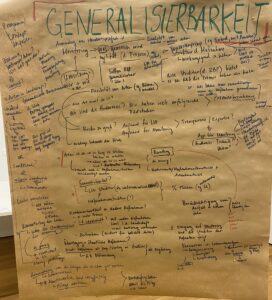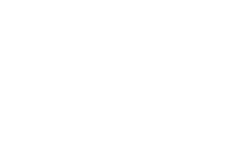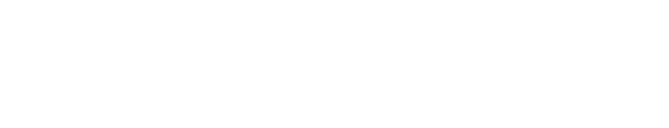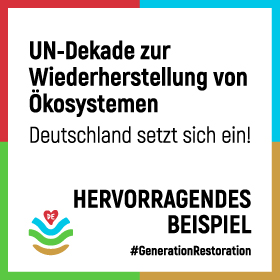➝ Technische Universität Dresden (TUD):
Professur für Modellbasierte Landschaftsökologie: Prof. Dr. Anna Cord, Dr. Lisanne Hölting, Dr. Nina Hagemann, Dr. Jan Engler, Julian Wendler, Felix Zichner, Anja Steingrobe;
Professur für Maschinelles Lernen für Computer Vision: Prof. Dr. Björn Andres, David Stein
➝ Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen e.V. (LPV): Stefanie Bülow, Andreas Vierling
➝ Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU): Prof. Dr. Frank Wätzold, Dr. Astrid Sturm, Dr. Charlotte Gerling, Dr. Nonka Markova-Nenova
➝ Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF): Dr. Maria Kernecker
➝ Nationale Naturlandschaften e.V. (NNL): Dr. Neele Larondelle, Kerstin Emonds
➝ Prof. Dr. Andrea Knierim (Agrarsoziologie; Universität Hohenheim)
➝ Dr. Stefan Schröder (Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)
➝ Dr. Michael Beckmann (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Landschaftsökologie)
➝ Honorarprof. Dr. Dr. Martin Drechsler (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ; Ökologisch-ökonomische Modellierung)
➝ Thomas Klepel (Naturpark Dübener Heide)